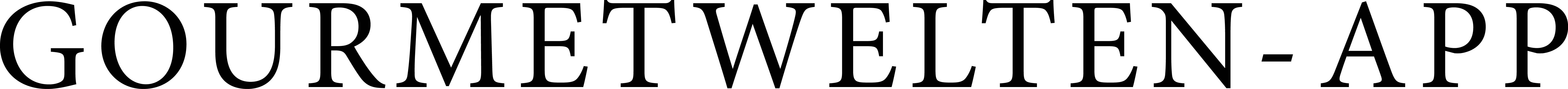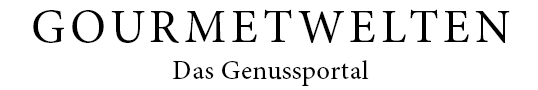Von Andrea Löbbecke
«Buttriger Melonenduft, verbundenes Holz, etwas leicht und kurz, mollige Frucht, rustikaler Abgang, stoffige Fülle, ausladener Nachhall, minzgeprägter Rosenholzduft». Für Professor Rainer Jung sind derartige Geschmacksbeschreibungen für Wein wenig verständlich. «Dieses Jägerlatein schreckt Weinkonsumenten, die den Zugang zum Produkt suchen, mit Sicherheit ab. Weil sie sagen: "Das verstehe ich nicht"», erklärt der Sensorikexperte an der Forschungsanstalt Geisenheim im Rheingau.
Jung ist nicht der einzige, dem die deutsche Weinsprache spanisch vorkommt: Viele Fachausdrücke für Wein sind auch nach Einschätzung des Weinmachers Dirk Würtz nur von einer verschwindend geringen Minderheit nachvollziehbar - nämlich von professionellen oder passionierten Weintrinkern. «Für alle anderen Menschen ist das eine Geheimsprache», sagt der Wein-Blogger aus Gau-Odernheim in Rheinhessen. Auf der anderen Seite seien für das eine Prozent der «Sprachheiligen» Begriffe wie «lecker» oder «schmeckt mir» an Banalität quasi nicht zu übertreffen. Ein Unding, meint Würtz. «Wenn ich einen Wein beschreibe und mein Gegenüber braucht Minimum ein Hochschulstudium, um das zu verstehen, dann ist das total verfehlt.»
Viele Begriffe aus der Weinsprache findet Würtz elitär. «Beim Geruch wird etwa der Vergleich gezogen zu Renekloden oder Sternanis - aber das kennt doch kein Schwein.» Wer seinen Wein nach «reifen Litschi aus Samoa» duften lasse, der lasse auch gleichzeitig durchblicken, was für ein tolles Feinschmeckeressen er sich leisten könne. «Bei uns nennt man sowas Strunzerei. Die Sprache dient hier der Ausgrenzung.»
Viel besser seien Assoziationen aus dem Alltag, etwa nasses Laub oder nasses Holz. «Das kennt jeder», sagt der Winzer. Seiner Meinung nach muss die Weinsprache entmystifiziert werden. Wein sei eine sehr emotionale, aber auch eine sehr individuelle Angelegenheit. Und dabei sei doch entscheidend: Lecker oder nicht lecker?
Weinprofessor Jung möchte den Studenten in seinen Seminaren beibringen, wie es besser geht. «Sie sollten zum Beispiel sagen, ein Wein riecht nach Banane oder nach Eisbonbon - dann kann sich das jeder vorstellen», sagt der Dozent. Zu den Unwörtern zählen nach seinen Worten auch «geschmeidig», «fleischig», «stark», «stahlig» und «kernig». Verunsicherte Verbraucher blieben dann unter Umständen eher beim Bier.
Es gibt noch andere Herangehensweisen: «Insgesamt hat sich die Weinsprache in den letzten 20 Jahren wesentlich verändert», sagt Sommelière Natalie Lumpp in Baden-Baden. So seien inzwischen auch Bezüge zu anderen Bereichen erlaubt - die Weinneulingen den Einstieg erleichterten. «Ich vergleiche Weine mit Menschen. Chardonnay etwa ist für mich eine Rubensfrau, Merlot wie ein schön hergerichtetes Mädchen mit pinkfarbenem Lippenstift und Highheels.» Oder Musikinstrumente: «Ein Weinexperte fragte mich neulich: ist der Riesling eher eine Klarinette oder eine Oboe», erzählt Lumpp. Es sei natürlich die Klarinette gewesen - leicht und fein.
Nach der Erfahrung der Sommelière sollten Kenner die Weinsprache vorsichtig und dosiert anwenden. Sonst wendeten sich die Menschen ab. «Aromen im Wein zu erkennen, ist reines Training.» Zwei bis drei Aromen seien sinnvoll - dann könne man sich den Wein auch besser merken. Woher die Weinbegriffe kommen, das kann keiner der Fachleute so genau erklären. «Heute wird ja mehr denn je über Wein geschrieben, da muss man auch ein bisschen kreativ sein», sagt Lumpp. Gute Begriffe setzten sich dann durch. «Primär geht es aber immer darum: Schmeckt mir oder schmeckt mir nicht.» dpa