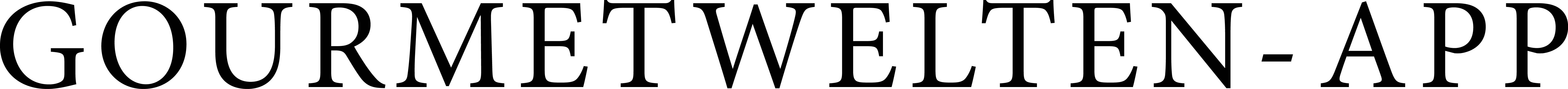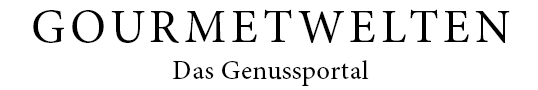Von Peter Zschunke
Einst hat die Reblaus in den Weinbergen Angst und Schrecken verbreitet. Mit steigenden Temperaturen wächst in allen deutschen Anbaugebieten die Sorge, dass Reblausbefall erneut zum Problem werden könnte.
«Die Reblaus ist nach wie vor eine ernstzunehmende Gefahr», sagt die Institutsleiterin an der Hochschule Geisenheim im Rheingau, Annette Reineke. «Im letzten sehr heißen und sehr trockenen Jahr 2018 haben wir in vielen Weinbergsregionen einen ganz deutlichen, zum Teil sehr plötzlichen und starken Befall mit Blattrebläusen beobachten können.» Wahrscheinlich habe die Reblaus von warmen Temperaturen und fehlenden Niederschlägen profitiert. Die genauen Zusammenhänge seien aber noch unklar.
«So ganz ausgerottet ist sie nicht», sagt auch der Abteilungsleiter Weinbau bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Markus Heil. Er erhalte zunehmend Anfragen von Winzern, in deren Region Rebläuse aufgetreten seien.
Nach einem Bericht der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ist die Reblaus mit Ausnahme von Zypern und den neuen nordeuropäischen Anbaugebieten überall in der EU präsent. Bei einem Befall der Wurzeln wird das Gefäßsystem der Pflanze beschädigt, was bis zum völligen Absterben führen kann. Bei der Reblaus-Epidemie im späten 19. Jahrhundert mussten alle Weinstöcke gerodet werden.
Heute bedeutet die Reblaus nach Angaben des Deutschen Weininstituts Kosten von 3000 bis 4000 Euro pro Hektar. Die Neuanlage von einem Hektar Weinberg bedeutet Gesamtkosten von rund 30 000 Euro. Die Anbaufläche in Deutschland umfasst 102 000 Hektar.
«Zur Panikmache besteht kein Anlass, aber wir müssen im Rahmen der Vorsorge weiter auf die Reblaus achten», sagt der Pflanzenschutzexperte Joachim Eder, der beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt an der Weinstraße für die Reblausbekämpfung zuständig ist. Die Winzer könnten sich weiter auf die Widerstandsfähigkeit des sogenannten Pfropfrebenanbaus verlassen.
Dabei werden europäische Rebsorten auf das Holz von amerikanischen Reben gepropft. Diese widersetzen sich der schädlichen Wirkung der Reblaus an den Wurzeln, sind daher «reblaus-tolerant». So wurde die Gefahr nach dem epidemischen Auftreten der aus Nordamerika stammenden Reblaus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingedämmt.
Der Befall mit Phylloxera, wie die Reblaus in der Fachsprache bezeichnet wird, tauchte innerhalb Europas zuerst 1862 in Frankreich auf. 1872 folgten Österreich und Ungarn, 1873 die Schweiz, 1875 Spanien, 1879 Italien und 1881 Deutschland.
Als Konsequenz aus dieser Epidemie ist der neue Anbau von «wurzelechten» Reben, also ohne Unterlage, in den meisten Anbaugebieten nicht mehr zugelassen. «So hat man die Reblaus gut in Schach gehalten», erklärt Heil.
Die DLR-Experten mahnen die Winzer, alles zu unterlassen, was die Vermehrung der Reblaus begünstigen könnte. Dazu gehört auch die Kultivierung wurzelechter Reben über sogenannte Einleger, etwa um eine Lücke in der Rebzeile zu schließen. Dabei werden Reben niedergebogen und in die Erde gesteckt, bis sich Wurzeln bilden und die Verbindung zur Mutterpflanze getrennt wird.
Auch an Unterlagsreben könne sich die Wurzelreblaus weiter vermehren, erklärt die Forscherin Annette Reineke - «sie ist weiterhin präsent in den Böden vieler Weinbergsregionen». Es bestehe die Gefahr, dass sich im Laufe der Zeit neue Reblaus-Biotypen bilden könnten, die dann möglicherweise in der Lage seien, die Widerstandsfähigkeit der Unterlagsrebsorte gewissermaßen zu durchbrechen. «Dies würde dann eine Reduktion der Reblaus-Toleranz bedeuten mit entsprechenden Schäden und Problemen.»
Gefahren gehen aus von verwilderten Reben - etwa an Straßenböschungen - sowie von den sogenannten Drieschen. Das sind Rebflächen, die nicht mehr bewirtschaftet, aber auch nicht gerodet werden und daher sich selbst überlassen sind. Dort könnten sich durch Mutationen neue Reblaus-Typen entwickeln, die aggressiver sind. «Man darf der Reblaus keinen vollständigen Generationszyklus ermöglichen», sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI). «Es ist daher ein wichtiger Teil der Rebgesundheit, dass Drieschen entfernt werden.»
In der Pfalz und in Rheinhessen, den beiden größten Weinanbaugebieten in Deutschland, komme es eher selten vor, dass Flächen aufgegeben würden und dann ungenutzt blieben, sagt Heil. «Das Interesse von Nachbarn einer Parzelle ist so groß, dass kaum eine Fläche unbewirtschaftet bleibt.» In kleineren Anbaugebieten mit Steillagen komme es häufiger zu Drieschen. Bei einer schlechten Preisentwicklung auf dem Fassweinmarkt könne es sein, dass die aufwendige Bewirtschaftung aufgegeben werde und sich so schnell kein Nachfolger finde. Die Landwirtschaftskammer fordert die Eigentümer dann auf, die Bewirtschaftung entweder wiederaufzunehmen oder die Fläche zu roden.
«Wir achten darauf», sagt die Winzerin Lotte Pfeffer-Müller vom rheinhessischen Weingut Brüder Dr. Becker in Ludwigshöhe. «Als Bio-Betrieb sind wir doppelt empfindlich, denn es gibt nichts, womit wir die Reblaus wieder einfangen können, wenn sie im Boden ist.» dpa