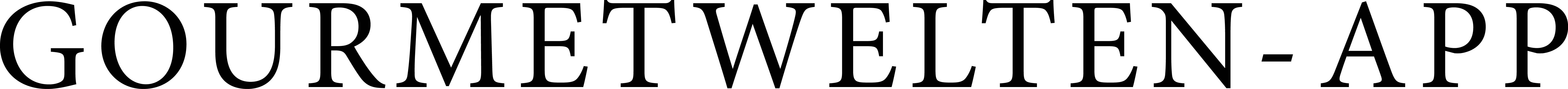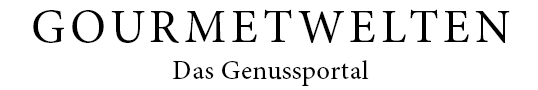Verbraucherschützer, Lebensmittelbranche und Opposition haben der Bundesregierung vorgeworfen, den Schutz regionaler Spezialitäten aus Deutschland aufgeben zu wollen. «Wo Nürnberg, Thüringen, Schwarzwald drauf steht, soll auch genau das drin sein», verlangte die frühere Bundesagrarministerin Renate Künast (Grüne). Amtsinhaber Christian Schmidt (CSU) hatte betont, im Zuge des geplanten transatlantischen Freihandelsabkommens zwischen EU und USA (TTIP) könne man nicht mehr alle Wurst- und Käsesorten schützen.
Schmidts Sprecher stellte nach massivem Protest am Montag klar: «Mit ihm wird es keine Nürnberger Rostbratwurst made in Kentucky geben.» Er stehe dazu, dass die geschützten Herkunftsbezeichnungen bleiben. Es gehe dem Minister vielmehr darum, dass im Rahmen der Verhandlungen mit den USA die europäischen Vorschriften zum Schutz traditioneller und regionaler Spezialitäten auch in Europa wieder ernster genommen werden. «Wo es geht, sollten sie aber auch entbürokratisiert werden.»
Bei vielen von der EU als regionale Spezialität eingestuften Lebensmitteln kommen Bestandteile schon heute nicht aus der Region. Künast und die Verbraucherorganisation Foodwatch pochten daher generell auf klare Herkunftsbezeichnungen. Schmidts Sprecher betonte, der Minister setze sich dafür ein, «dass es weder Parmaschinken made in USA gibt, noch Feta-Käse aus Dänemark.»
Es gehe nicht um eine Abschaffung, sondern um mehr Schutz der Herkunftskennzeichnung: «So muss der fränkische Bocksbeutel auch Frankenwein enthalten. Und wir müssen umgekehrt auch akzeptieren, dass Wein aus dem Napa Valley auch nur dort produziert werden kann und nicht in Europa.»
Der Koalitionspartner SPD mahnte Schmidt zum Einsatz für regionale Produkte. «Das ist für viele Menschen eine emotionale Geschichte», sagte die SPD-Verbraucherpolitikerin Elvira Drobinski-Weiß der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe keine Lust auf Schwarzwälder Schinken aus den USA, der mit irgendeinem Aromastoff versetzt ist.»
Mehr Globalisierung dürfe nicht bedeuten, den Schutz regionaler Produkte zu opfern. Der Hauptgeschäftsführer der Spitzenverbände der Lebensmittelwirtschaft, Christoph Minhoff, sagte der «Bild»-Zeitung: «Regionale Spezialitäten müssen regionale Spezialitäten bleiben. Wir wollen keine Original Nürnberger Rostbratwürstchen aus Kentucky.»
Das neue Schreckgespenst: Rostbratwürstchen aus Kentucky
Kölsch aus Minnesota? Bayerische Brezen aus Boston? Hessischer Apfelwein aus Kalifornien? Oder schwäbische Maultaschen aus Chicago? Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) hat einen Testballon steigen lassen - und einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.
All diese Produkte stehen auf der EU-Liste besonderer regionaler Spezialitäten. Aber in den Verhandlungen über das transatlantische Freihandelsabkommen mit den USA könnte der Schutz zum Teil fallen. Schmidt hatte im «Spiegel» betont: «Wenn wir die Chancen eines freien Handels mit dem riesigen amerikanischen Markt nutzen wollen, können wir nicht mehr jede Wurst und jeden Käse als Spezialität schützen.»
Am Montag hat sein Sprecher sichtbar Mühe, die Worte wieder einzufangen, denn vom Bauernverband bis zu Verbraucherschützern gibt es große Irritation. Der Vizechef der Linken-Fraktion, Klaus Ernst, sieht sich in seinen Warnungen vor dem TTIP-Abkommen bestätigt: «Das geht zulasten der Hersteller in Europa, die Spitzenqualität auf den Markt bringen». Die Liste der Zugeständnisse an die USA wird immer länger», so Ernst.
Schmidt will seine Worte nun vor allem so verstanden wissen, dass angesichts von weit über 1000 Siegeln und Regionalprodukten in der EU nicht alles geschützt werden könne. Aber eine Original Nürnberger Rostbratwurst aus Kentucky oder Schwarzwälder Schinken made in USA will der Bayer verhindern. Was stimmt: Schon heute kommen viele Grundstoffe gar nicht aus der jeweiligen namensgebenden Region, umso wichtiger scheinen künftig klare Regeln für Herkunftsbezeichnungen. Dann liegt es beim Verbraucher, ob er Original oder Kopie kauft.
«Mindestens 90 Prozent des für Schwarzwälder Schinken verwendeten Schweinefleischs kommt zum Beispiel nicht aus dem Schwarzwald, und darf trotzdem ganz legal als regionales Produkt vermarktet werden», meint Thilo Bode, Geschäftsführer der Organisation Foodwatch.
Die Bürger treibt das Abkommen ziemlich um. Zum Symbol einer angeblich drohenden Absenkung von Verbraucher- und Umweltstandards wurde das Chlorhühnchen. Der für die Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) federführend zuständige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel meinte bei einem USA-Besuch: «Dass da etwas nicht stimmt, sieht man, wenn dieselben Menschen, die das Chlorhuhn fürchten, ihre Kinder bedenkenlos ins Schwimmbad schicken, wo die dann selbst den ganzen Tag in Chlor baden.»
Der SPD-Chef beklagt vor allem in seiner Partei irrationale Sorgen, er wolle einen wirtschaftsfreundlichen Kurs und daher als ersten Schritt das Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) unter Dach und Fach bringen. Es liegt vor allem wegen Bedenken in Deutschland auf Eis.
Es dient als Blaupause für TTIP, gelockt wird auch mit vielen neuen Arbeitsplätzen. Nun ist es Sinn solcher Verhandlungen, dass beide Seiten Zugeständnisse machen - so hoffen deutsche Autobauer durch einheitliche Standards und den Wegfall von Zöllen auf mehr Absatz in Nordamerika. Allein sie würden mit TTIP pro Jahr rund eine Milliarde Euro an Zoll sparen, betont der Verband der Automobilindustrie (VDA).
Und das Bundeswirtschaftsministerium verweist auch mit Blick auf die Lebensmittel auf enorme Chancen, schließlich winken auch für die regionalen Delikatessen neue Absatzmöglichkeiten. So könnten Äpfel und verschiedene Käsesorten bisher gar nicht in die USA exportiert werden. «Auf andere Produkte erheben die USA hohe Zölle, etwa auf Fleisch 30 Prozent, auf Getränke 22 bis 23 Prozent und auf Molkereierzeugnisse bis zu 139 Prozent», betont das Ministerium.
Gabriel und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen bei TTIP auch den transatlantischen Raum stärken, damit Märkte und politisches Gewicht nicht noch stärker nach Asien abwandern. Die SPD wird sich bis zum Sommer bei einem kleinen Parteitag erneut mit Ceta und TTIP befassen - bisher dreht sich die Debatte vor allem um eine mögliche «Paralleljustiz für Konzerne». Es soll verhindert werden, dass Staaten vor privaten Schiedsgerichten verklagt werden können, wenn Konzernen bestimmte Regeln - etwa bei Lebensmitteln - nicht passen.
Seit Mitte 2013 wird in rund 20 Arbeitsgruppen über TTIP verhandelt, in Deutschland gibt es parallel Bürgerforen und Gabriel hat einen Beirat mit Vertretern der Zivilgesellschaft eingerichtet. Die Verhandlungen dürften sich bis mindestens 2016 hinziehen. Die große Koalition wird noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, nach der SPD könnte die Debatte gerade auch in der bayerischen CSU noch munter werden. Derzeit läuft übrigens bei der EU ein Antrag, auch Oktoberfestbier als besondere regionale Spezialität einzustufen.
Höfken warnt vor Folgen von TTIP für rheinland-pfälzische Weine
«Moselwein made in USA»? Vor den möglichen Folgen des geplanten USA-Freihandelsabkommens TTIP hat die rheinland-pfälzische Weinbauministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Montag gewarnt. «Die Bundesregierung muss unsere deutschen regionalen Weine vor unlauterem Wettbewerb und die Verbraucher vor irreführenden Bezeichnungen schützen», teilte Höfken in Mainz mit. Sie verschärfte damit ihre Kritik und reagierte auf Aussagen von Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU). Er hatte dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» gesagt, der Schutz regionaler Spezialitäten könne sich mit TTIP ändern.
In Rheinland-Pfalz beträfe TTIP nur den Wein, sagte Susanne Umbach von der Verbraucherzentrale in Mainz. Bislang gewährleisten Gütezeichen der EU-Kommission, dass zum Beispiel Nürnberger Lebkuchen in Nürnberg hergestellt wird und die Zutaten für Allgäuer Emmentaler aus dem Allgäu kommen. Andere Lebensmittel mit «geschützter geografischer Herkunft» gebe es im Land nicht.
Für Umbach sind diese besonderen Lebensmittel nur ein Nebenschauplatz von TTIP. Ernährungsexperten fürchteten viel mehr, dass zum Beispiel europäische Hygiene-Standards aufgeweicht würden. dpa