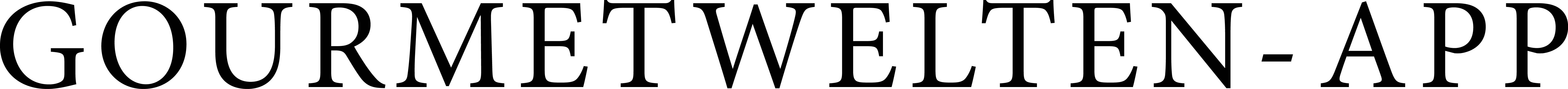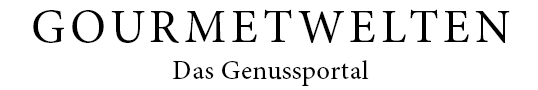Von Sebastian Kretz
Der letzte Bissen Lamm ist kaum geschluckt, da ruft David, man müsse jetzt dringend losfahren, schließlich wolle ich doch die Stadt sehen. Gern wäre ich noch eine Weile sitzen geblieben, denn mein neuseeländischer Gastgeber wohnt in den Hügeln im Süden Dunedins, und an Sommerabenden zeigt der Blick nach unten eine golden leuchtende Stadt vor dem sanft geschwungenen Grün der Halbinsel Otago, umrahmt vom stahlblauen Pazifik. Aber David ist Neuseeländer, und das bedeutet: Draußen ist besser als drinnen, und Bewegung ist besser als Ruhe. Also ab in die Stadt.
Stadt? In Neuseeland? Zugegeben: Das Land am Ende der Welt besticht nicht unbedingt durch Museen, Opernhäuser und prächtige Boulevards. Und doch werden seine Städte zu Unrecht vernachlässigt, wenn auch ihr Reiz ein ganz anderer ist: Dunedin etwa, mit 120 000 Einwohnern die viertgrößte Stadt im Südosten des Landes, ist der ideale Ausgangspunkt für leichte Tagestouren ins Umland. Man braucht weder Wanderschuhe noch Paddelboot, nicht einmal besondere Ausdauer.
Und während viele neuseeländische Orte lose Sammlungen vorstädtischer Wohngebiete ohne wahres Zentrum sind, hat Dunedin eine Stadtmitte, wie sie europäischer kaum sein könnte: Das Oktagon, der achteckige Platz im Zentrum der Stadt, ihr Schaukästchen.
«Im Goldrausch der 1880er Jahre stieg Dunedin zur reichsten und größten Stadt Neuseelands auf», erklärt David. Er zeigt auf den viktorianischen Prachtbau des Rathauses, gekrönt von einem prächtigen Glockenturm, der einen ganzen Straßenblock einnimmt. Daneben die neogotische Kathedrale St. Paul, Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet, schlank und doppeltürmig. Es folgen, rund um den Platz, das Theater und die Dunedin Public Art Gallery, die unter anderem Werke von William Turner und Claude Monet zeigt.
Unter den Bäumen in der Mitte des Platzes sitzen Stadtbummler und Studenten, die ein Fünftel der Bevölkerung Dunedins stellen. Zwei Einkaufsstraßen kreuzen das Oktagon, an ihnen reiht sich Bistro an Bar, Café an Pub, Steakhaus an asiatisches Restaurant. Wenn die Sommerferien vorbei sind und die Studenten zurück in die Stadt strömen, verwandelt sich die Altstadt in einen Ameisenhaufen. Wir laufen die George Street nach Norden hoch zur Universität. Der Campus erinnert mit seinen verspielten Gebäuden aus Basalt und Kalkstein, den Schattenplätzen unter mächtigen Bäumen und dem plätschernden Bach an englische Universitätsstädte.
Man könnte hier den ganzen Nachmittag vertrödeln, aber David findet, es sei nun genug des Stadtbummels. Wir fahren also ins Grüne, nach Otago. Auf den bergigen Wiesen der weitläufigen, der Stadt vorgelagerten Halbinsel weiden Schafherden zwischen spärlichen Sträuchern, dazwischen blitzt immer wieder der Pazifik auf.
Furchtlos brettert David die kurvenreiche Portobello Road entlang der Küste hinauf. Je steiler es bergan geht, desto mehr öffnet sich der Blick aufs Festland gegenüber, über dem an diesem Tag tiefe, graue Wolken hängen. Wie in Schottland, denke ich, würden nicht immer wieder Zeder, Eukalyptus und der palmenartige Cabbage Trees daran erinnern, dass dieser Landzipfel hier nicht im Norden Europas liegt, sondern im äußersten Süden der besiedelten Welt.
An der Spitze der Halbinsel, dem Taiaroa Head, steht ein Leuchtturm mit roter Kappe auf einer hohen Klippe. Gleich daneben nistet eine Albatros-Kolonie. Die schlanken, weißen Vögel gehören mit einer Spannweite von etwa drei Metern zu den größten der Welt. Ihre Kolonie hier ist weltweit die einzige auf dem Festland. Leider ist den Riesen nicht nach Fliegen zumute, als wir ankommen.
Zum Ausgleich stapft David einen Trampelpfad Richtung Meer hinab. «Mal sehen, ob welche da sind.» Erst als wir vor einem Zaun stehen bleiben und er auf die moosbewachsenen Felsen zeigt, sehe ich die Robben, genauer gesagt: südliche Seebären. So heißen diese pelzigen Meeressäuger. Träge liegen die massigen, dunklen Tiere auf den Steinen, das aufgeregte Kreischen der Möwen stört sie so wenig in ihrer nachmittäglichen Ruhepause wie die Neugier der Menschen. Als wir wieder zum Auto laufen, zeigt David wortlos nach oben: Da fliegt doch noch ein Albatros, oder besser: segelt hoheitsvoll mit seinen mächtigen Flügeln über uns hinweg.
Am nächsten Tag hat David seine Enkelin Leagh eingespannt. Sie arbeitet in Dunedins gewaltigem Bahnhof, ebenfalls gebaut mit dem Geld aus dem Goldrausch, ein Palast aus Basalt und Granit, über dessen Erkern und Giebeln sich ein 37 Meter hoher Turm erhebt. «Der Bahnhof ist Neuseelands meistfotografiertes Gebäude», sagt Leagh, dabei sind die meisten Verbindungen seit Jahrzehnten stillgelegt. Für längere Strecken nehmen die Neuseeländer Auto oder Flugzeug.
Umso beachtlicher ist die einzige noch betriebene Strecke: «Der Taieri Gorge Railway ist die Zugstrecke ins Landesinnere», erklärt die junge Frau. Beinahe bis zur Quelle folge er dem Flüsschen Taieri, das sich durch steile Schluchten aus zerklüftetem Schiefer zwingt. Für die Eisenbahn bedeutet das: Scharfe Kurven, schmale Tunnel und Viadukte in schwindelerregender Höhe, stets zu Füßen der immer steiler aufragenden Felsen. Die Strecke führt nach Pukerangi, «Hügel der Himmel» bedeutet das in der Sprache der Maori. Weil es entlang der Strecke kaum Siedlungen gibt, fahren fast nur Touristen mit.
Die altmodischen Waggons aus den 1920er Jahren sind orangegelb lackiert, vorn eine stämmige Diesellok, drinnen dunkles Holz. Der Zug rumpelt los, und sobald er das weite Tal verlässt, in dem der Taieri zum Meer fließt, verändert sich die Landschaft: Aus dichtem, dunkelgrünen Nadelwald wächst zerklüftetes Gebirge, spärlich bewachsen, übersät mit Felsbrocken. Es geht über gewagte Brücken, die immer großzügigere Ausblicke auf reißendes Wasser, scharfkantige Gipfel und den hohen, neuseeländischen Himmel freigeben - der Wingatui Viaduct ist beinahe 200 Meter lang und spannt sich in 47 Metern Höhe über den Fluss.
Nach zwei Stunden hält der Zug mitten im grünen Nichts: Endstation Pukerangi - kein Bahnhof, kein Bahnsteig, nur ein paar Bäume. Leagh klettert aus dem Zug und steuert zielstrebig eine einsame Frau hinter ihrem kleinen Stand an. Als sie zurückkommt, bringt sie päckchenweise Fudge mit, jene mürben Karamellbomben, die so typisch sind für die Küche des Landes: Zuckersüß und reichhaltig jenseits aller Vernunft. dpa
dunedinnz.com