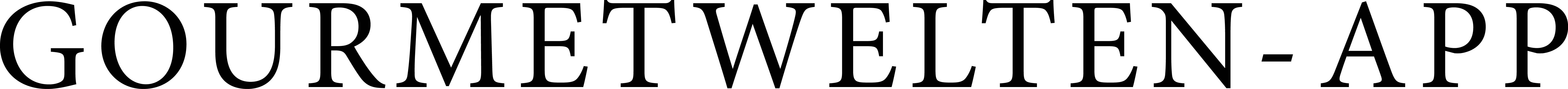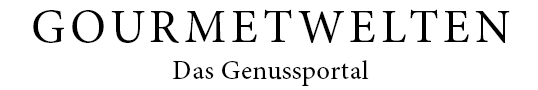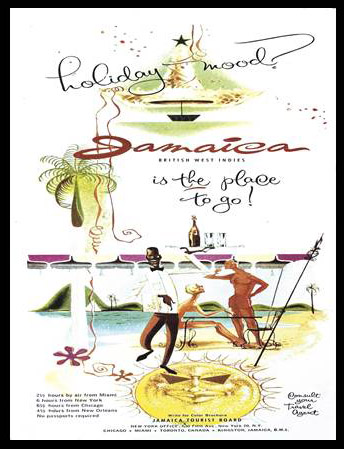Die Jamaikavögel mit ihren spitzen Schnäbeln sehen recht bedrohlich aus. Über den Menschen baumeln sie an dünnen Fäden von der Decke. Die Kunstvögel in den Landesfarben schwarz-grün-gelb im Flughafen von Kingston sollen an 55 Jahre Unabhängigkeit Jamaikas von den Briten erinnern. Am seidenen Faden scheint ja irgendwie auch die Koalitionssuche 8500 Kilometer entfernt in Berlin zu hängen.

In Deutschland wird der Name Jamaika dieser Tage gekapert von Politikern und Medien - wegen der Landesfarben. Wenn es keine Begrenzung auf 200 000 Flüchtlinge pro Jahr im Koalitionsvertrag gebe, «bleibt Jamaika eine Insel in der Karibik und wird keine Koalition in Berlin», sagte etwa der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Nun, nicht nur aus der Distanz und mit einem Ozean zwischen den ungleichen Schauplätzen lässt sich sagen: Auch ohne Koalition von CDU/CSU (schwarz), FDP (gelb) und Grünen (grün) dürfte Jamaika eine Insel in der Karibik bleiben. Mit höchst eigenem Charakter.
Jamaika, das steht vielfach für Klischees wie Reggae, Rastafari, für Musiker wie Bob Marley. Für Temperaturen, die im Schnitt selten unter 25 Grad liegen. Auf einer Fläche etwas größer als die Mittelmeerinsel Zypern leben knapp drei Millionen Menschen - weniger als in Berlin.
Über 90 Prozent stammen von verschleppten Sklaven aus Afrika ab. Es steht auch für Armut und Kriminalität. Doch was treibt die Menschen dort im Alltag um? Die Leute, die so gerne «Yah, man» sagen? Was denken sie über die Nutzung ihres Staatsnamens in Berlin, welche Verbindungen zu Deutschland gibt es? Unterwegs auf Spurensuche.
Claire McPherson sitzt den Tag über von 8 bis 15 Uhr im trüben Neonlicht hinter ihrem Schreibtisch in der Hauptstadt Kingston. Zur Linken türmen sich vergilbte Aktenordner. Die 82-Jährige leitet das «Jamaican Institute for Political Education». Früher war das Institut einer der wichtigsten Think Tanks des Landes, gefördert von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung aus Deutschland. «Am Tag kommen drei, vier Besucher», erzählt Claire McPherson über die geschrumpfte Bedeutung. Der Ventilator kreist, die Zeit wirkt stehengeblieben.
Jamaikas Demokratie gilt heute zwar als stabil. Aber die Bindungskraft der Parteien gehe verloren - ein aus Deutschland bekanntes Phänomen. Doch hier nimmt es andere Formen an: «Die Kirchen und Sekten sind viel einflussreicher, auf die hören die Menschen», klagt McPherson. Und berichtet von Aktivismus abseits der Parteien:
«Und wer etwas durchsetzen will, blockiert einfach eine Straße.»
Alte Computer, verstaubte Faxgeräte, in der Ecke steht auf dem Boden neben dem Mülleiner ein Bild vom Mauerfall, das Glas gesprungen. Dazu der Spruch: «Open borders, open hearts - The Germans, one nation.» («Offene Grenzen, offene Herzen - die Deutschen: eine Nation.»).
«Mein Mann ist im März gestorben, er hat das Institut zehn Jahre lang mit Leidenschaft geleitet, ich führe sein Erbe fort», sagt McPherson.
EIN BRUDER, DER IM SCHWARZWALD WOHNT
Angesprochen auf die «Jamaica Coalition», muss sie schmunzeln, «What? Hihi, funny.» In Jamaika sind Koalitionsregierungen, die ungleiche Partner je nach Wählerwillen zusammenbringen, unbekannt. Es konzentriert sich, wie in den USA und Großbritannien, auf zwei große Parteien. Staatsoberhaupt ist formal die britische Queen Elizabeth II.. 18 Jahre regierte die Volkspartei. Seit 2016 ist die Labour Party dran. An der Spitze steht Premierminister Andrew Holness.
McPhersons Institut ist im Labour-Hauptquartier untergebracht. Die Leiterin hat sogar eine Verbindung nach Deutschland: Ihr Bruder lebe dort, im «Black Forest», im Schwarzwald. Einen Anruf später hat sie herausgefunden, dass er in Freiburg wohnt. Sie holt Broschüren heraus, von 1996, von der «Konrad Adenauer Memorial Lecture» in Kingston, in Erinnerung an den Kanzler und den Demokratieaufbau in der Bundesrepublik. Thema der Veranstaltung: «Der Einfluss des Wandels in Europa auf die Karibik». Es gab damals viel Hilfe beim Aufbau einer stabilen Demokratie in Jamaika und des Justizsystems.
«Aber heute gibt es kein Geld mehr», sagt McPherson ernüchtert.
Jamaika ist für Deutschland nicht gerade ein Hotspot, die wichtigsten Handelspartner der Insel sind die USA und Kanada. Rund 300 Deutsche leben in dem Inselstaat.
Das Auswärtige Amt betont: «Die Beziehungen zwischen Deutschland und Jamaika sind seit Jamaikas Unabhängigkeit 1962 freundlich und problemfrei.» Die Deutsche Botschaft in Kingston liegt übrigens, man sollte es nicht als Omen für eine mögliche Jamaika-Koalition in Berlin werten, in der «Waterloo Street». Interessant am Rande:
Botschafter Joachim Schmillen war früher mal Büroleiter des einzigen grünen Außenministers Joschka Fischer.
Seit 2010 gab es für den gesamten karibischen Raum Entwicklungsgelder in Höhe von 62 Millionen Euro, etwa für den Schutz der Küsten und die Anpassung an den Klimawandel. Für Unternehmen aus Deutschland könnte gerade der Bereich erneuerbare Energien - Stichwort viel Sonne und Wind - spannend sein. Der meiste Strom kommt hier bisher aus einem Ölkraftwerk. In der Realität bauen Kanadier Autobahnen und Chinesen Hochhäuser. In einer Radiosendung lobt ein Anrufer den Fleiß der chinesischen Arbeiter, während einheimische zu teuer und faul seien - was ihm einen Wutanfall des Moderators beschert.
Übrigens spielt auch in Jamaika ein Zahlenziel eine wichtige Rolle.
Während in Berlin die «schwarze Null» - keine Neuverschuldung - zur Losung wurde, gilt in Kingston ein «5 in 4»-Plan: Fünf Prozent Wachstum in vier Jahren. So hat es Premier Holness versprochen.
BERÜCHTIGT FÜR HOMOPHOBIE
Das Plus klingt nach wenig, aber Jamaika leidet unter einer hohen Verschuldung im Ausland. Zudem werfen Zerstörungen durch Hurrikans das Land immer wieder zurück. Wichtige Einnahmequellen sind Urlauber an den Karibikstränden, Überweisungen der Jamaikaner, die im Ausland leben, und die Förderung von Rohstoffen wie Tonerde und Bauxit.
Die Armutsrate konnte zwar auf unter 20 Prozent der Menschen gesenkt werden, das Pro-Kopf-Einkommen liegt bei rund 4000 Euro im Jahr. Aber die Jugend sieht für sich oft nur magere Perspektiven. Viele sind arbeitslos. Nicht wenige wandern deswegen nach Nordamerika aus.
Jamaika ist kein Migrationsziel. Im Gegenteil. Es verliert Menschen.
Diplomaten betonen, dass das Land zwar beim Marihuanakonsum sehr liberal sei. Eine stärkere Freigabe ist ja auch ein Streitpunkt der Gespräche in Berlin. Beim Umgang mit Schwulen und Lesben dagegen sei Jamaika alles andere als tolerant. Angetrieben von evangelikalen Sekten - die Kirchendichte ist gemessen an der Bevölkerung eine der größten der Welt - ist Jamaika berüchtigt für seine Homophobie. Und die Dancehall-Bewegung, entstanden aus einer eingängigen Mischung aus Reggae und Hip-Hop, ist bekannt für schwulenfeindliche Liedtexte.
Als jüngst der protestantische Bischof Howard Gregory die Abschaffung des Sodomieparagrafen forderte, der auch gleichgeschlechtlichen Sex unter Strafe stellt, brach ein Sturm der Entrüstung los. Der Passus von 1864 droht bis zu zehn Jahre Haft an für «Verbrechen der Unzucht, begangen entweder zwischen Menschen oder mit Tieren». Es gab sogar Reisewarnungen wegen des schwulenfeindlichen Klimas - während in Deutschland seit kurzem die sogenannte Ehe für alle möglich ist.
EIN DEUTSCHES DORF: «WELCOME TO SEAFORD TOWN»
Aber jenseits aller Farbassoziationen - es gibt in Kingston sogar eine Deutsch-Jamaikanische Gesellschaft, 1954 gegründet. Diese bietet Sprachkurse an und lädt zum Oktoberfest ein.
Und es existiert ein ungewöhnlicher Ort, der sich auf alte deutsche Wurzeln beruft. Ihn zu erreichen, rund 160 Kilometer von Kingston entfernt, ist eine Herausforderung. Ohne Navigationsgerät keine Chance. Von der Hauptstraße kommend geht es noch lange durch ein Gelände, das an einen Truppenübungsplatz erinnert. Grüner Dschungel, Schlaglöcher, Abgründe. Plötzlich wie aus dem Nichts steht da ein
Stein: «Welcome to Seaford Town - The German Township, founded 1835».
Ein Mann namens Lord Seaford wollte nach Abschaffung der Sklaverei Arbeitskräfte gewinnen. Mit allerlei Versprechen wurde im damaligen Königreich Hannover um Auswanderer geworben. Der König von Hannover war auch König von Großbritannien. So kam es, dass sich Hunderte aus der Weserregion aufmachten nach Jamaika. Versprochen worden waren Häuser - doch die standen nicht. Viele Ankömmlinge starben an Malaria und Cholera. Noch heute zeugen überwucherte Ruinen und alte Häuser in dem 350-Seelen-Ort von dieser Migrationsgeschichte. Es leben aber kaum noch Weiße in Seaford Town. Viele heirateten andere Jamaikaner.
Zudem wanderten Hunderte Nachfahren in den 1950er Jahren nach Kanada aus. Irgendwann starb die deutsche Sprache in Seaford aus, als eine der wenigen Traditionen blieb das Spanferkelessen am Samstag. Einer der letzten direkten Nachfahren ist Curtis Hacker. Auf einer Mauer am Eingang zur Kirche wartet er an einem Sonntag auf den Beginn der Messe. Mit 56 Jahren ist der Handwerker wie sein Bruder Frührentner.
Beide gehören zur vierten Generation. Was weiß er über die deutschen Vorfahren? «Nichts Richtiges, hat mich nie so interessiert.»
Mit dem Land der Ahnen verbindet er nichts. «Nur mein Cousin war mal in Deutschland. Aber dem hat das Meer da, diese North Sea, gar nicht gefallen.» Curtis Hacker sagt: «Ich bin zu 100 Prozent Jamaikaner.» Sein Bruder zeigt später das alte Haus des Urgroßvaters am Fluss, im Hintergrund läuft laut Reggae. Es gab auch mal ein kleines Museum zur Einwanderungsgeschichte. Aber wegen Geldmangels machte es dicht.
Einige hoffen auf eine «Jamaika-Regierung» in Berlin oder die Deutsche Botschaft in Kingston, dass sie finanziell helfen, um die Geschichte aufzuarbeiten. Und um deutsche Traditionen wie Wurstmachen und Bierbrauen wiederzubeleben. Dann würden vielleicht sogar Touristen nach Seaford reisen.
Die realen Jamaika-Urlauber zieht es eher an die weißen Strände in Montego Bay im Nordwesten. Und ins hippe Negril, wo Klippenspringer und Sonnenuntergänge den Cocktail versüßen. Ein Ehepaar aus Thüringen betreibt die wohl einzige deutsche Bar Jamaikas, die «German Bar».
Auch hier ist das, was da im fernen Berlin passiert, kein Thema.
ZUM GAST BEIM KÖNIG DER RASTAFARI
Um die Ecke residiert Kyng Sharlo. Er nennt sich König der Rastafari und führt auf der Speisekarte seines «Rastarants» Hasch-Kekse und Marihuana-Tee. Auf dem Tisch stehen Wasserpfeifen. Der Kyng hat 1,50 Meter lange Dreadlocks, trägt schwarze Sonnenbrille. Aus den Boxen dröhnt Reggae. Jamaika-Koalition? Kyng Sharlo schaut ratlos. Er schüttelt den Kopf: «Nee, noch nie gehört.» Er rasselt erstmal mit seiner Rassel. Man muss sich diesen tiefenentspannten Musiker in dem Moment als friedensstiftenden Konfliktlöser im Kanzleramt vorstellen:
bei einem großen Koalitionskrach zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen.
Kyng Sharlo malt in das Notizbuch des Reporters ein Herz mit einem «R» für Rastafari, dazu Sonnenstrahlen und schreibt: «Universal Love». Statt weiter über diese Jamaika-Koalition zu grübeln, philosophiert er lieber über Probleme, eine geeignete Frau zu finden.
«Warum die meisten Frauen in Jamaika keinen Rastafari daten wollen?
Sie sind halt sehr amerikanisch und materialistisch orientiert.» Rastafari sei dagegen eine Religion, Geld und Besitz seien unwichtig, man wolle im Einklang mit der Natur und Musik leben, sehr spirituell.
Leider zerstöre der Einzug des Kapitalismus auch hier traditionelle Strukturen. Nur noch fünf Prozent seien echte Rastafari in Jamaika.
Dann rechnet er mit der Politik im Allgemeinen ab. Als Rastafari lehnt er das westliche Politikmodell und kapitalistische Strukturen ab. Bei der Rastafari-Bewegung spielt die afrikanische Herkunft der Vorfahren eine entscheidende Rolle. Sie verehrten bis heute Ras Tafari Makonnen, der 1930 als Haile Selassie zum Kaiser Äthiopiens gekrönt wurde, als einen schwarzen Gott. Sein Aufstieg galt einer Sekte in Jamaika als Anfang vom Ende der Herrschaft der Weißen.
WAS DEUTSCHLAND LERNEN KANN: MEHR LACHEN!
Von Negril und dem Rastafari-König geht es zurück nach Kingston, um Vernon Davidson zu treffen. Er führt als Chefredakteur eine der wichtigsten Zeitungen, den «Jamaica Observer». Er ist von einem Leser darauf aufmerksam gemacht worden, was sich da im fernen Deutschland zusammenbraut. «Hey, das passiert da gerade, meinte der Leser und schickte Artikel der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» und «Bild».»
Am 8. Oktober - zwei Wochen nach der Bundestagswahl - kam so der erste Artikel über eine «Jamaica Coalition in Germany» in seine Zeitung. Auflage: rund 150 000. Mit bis zu sieben Millionen Klicks im Monat ist der «Observer», so erzählt es Vernon Davidson, zudem eines der größten Nachrichten-Portale der Karibik.
1993 als Wochenzeitung mit 12 Mitarbeitern gestartet, beschäftigt das Blatt heute 300 Leute. Davidson ist amüsiert, dass Jamaika nun so oft in deutschen Medien auftaucht. Auf die Frage, was Deutschland von Jamaika lernen könne, bricht er in Lachen aus. «Genau das: Wir lachen gern und haben Spaß.» Und: Es gebe keinen Druck auf die Medien, keine Lügenpressevorwürfe. Weltweit liegt Jamaika auf Platz acht in Sachen Pressefreiheit - Deutschland auf Platz 16.
Chefredakteur Davidson mag Deutschland, vor allem den Fußball. In seinem Büro hat er «FC Bayern München TV» als Sender programmiert.
Und zum Abschied ist ihm eine Botschaft wichtig, unabhängig davon, ob Jamaika zur Koalition in Berlin wird. «Ihr müsst in Russland wieder Fußball-Weltmeister werden.» Er habe sich das Trikot mit dem vierten Titel-Stern gekauft, erzählt er mit Blick auf den 2014 errungenen vierten WM-Sieg. «Ich hätte gerne auch eins mit dem fünften Stern.» dpa