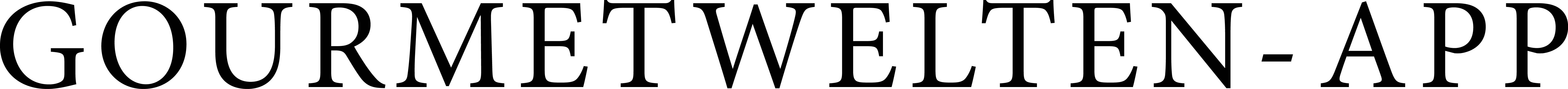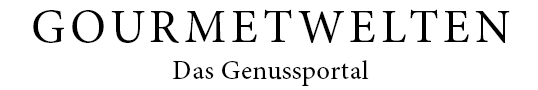Von Nina C. Zimmermann
Ein hefig-fruchtiger Geruch liegt in der Luft. Dicht an dicht stehen die Fässer reihenweise im gemauerten Kellergewölbe. Auf jedem Fass sitzt ein Glaskolben, über den die Kohlensäure entweicht, die bei der Gärung entsteht. Ein leises Gluckern zeugt davon. Auf dem Weingut von Winning in Deidesheim (Pfalz) gärt und reift der Weißwein traditionell im Holzfass.
Dadurch bekomme der Wein ein unverwechselbares Profil, ist Stephan Attmann überzeugt. Nicht nur der Boden im Weinberg, auch das Holz mache viel aus. «Die Fässer riechen unterschiedlich. Es gibt Aromen wie Butterscotch, gebrannte Mandeln oder geröstete Haselnüsse», erläutert der Betriebsleiter des Weinguts. Diese Aromen finden sich später auch im Wein. Auch Gerbsäuren und Fruchtsäuren entwickelten sich im Holzfass besser. «Es gibt keinen Wein, der aus Stahltanks kommt, der gescheit ist», sagt Attmann. «Reintönig, aber eintönig» sei das Ergebnis dann.
Auch andere Winzer in der Region setzen auf den vor allem in Frankreich schon lange verbreiteten Fassausbau. Einige von ihnen haben sich im Barrique Forum Pfalz zusammengeschlossen, das sich intensiv mit im Fass gereiften Rotwein beschäftigt. «Das Holz soll begleitend wirken», sagt etwa Frank Pfaffmann vom Weingut Wageck Pfaffmann in Bissersheim. Sein Spätburgunder reift zwölf Monate im Fass und verdankt seine intensiven Fruchtaromen einem innen leicht angerösteten Behälter aus französischer Eiche.
Thomas Lergenmüller vom Theodorus Wein- und Sektgut in Hainfeld lässt seine Rotweincuvée sogar 19 Monate im Fass. Dadurch lasse sich eine feinere Oxidation erreichen. «Das Bittere, Adstringierende soll runder, weicher werden», erklärt er.
Die Angabe «im Barrique gereift» ist laut dem Deutschen Weininstitut nur bei Qualitäts- und Prädikatsweinen zugelassen. Mindestens 75 Prozent des Weins müssen im Barriquefass gegoren, ausgebaut oder gereift worden sein - Rotwein für mindestens sechs, Weiß- oder Rosewein für mindestens vier Monate. Das Barriquefass darf nur ein Fassungsvermögen von höchstens 350 Litern haben.
Bis der Wein letztlich ins Fass kann, ist viel Arbeit nötig. Die stecken aber nicht nur die Winzer in die Reben, bis sie die Trauben ernten und verarbeiten können. Auch vom Baum zum Fass ist es ein langer Weg, wie sich bei einem Ausflug in den Pfälzer Wald zeigt. Dort werden seit Jahrhunderten Eichen kultiviert. Sie sind die Grundlage von Barrique- und anderen Fässern.
«Eichen bedeuten intensive Pflege», erläutert Burkhard Steckel, Leiter des Forstamts Johanniskreuz. 250 bis 300 Jahre brauche ein Baum, bis er groß genug ist, bei anderen Gehölzen seien es nur 150 oder sogar weniger als 100 Jahre. Pro Jahr lege eine Eiche einen Milliliter im Umfang zu, «zwei, wenn sie sich in ihrer Jugend anstrengt», sagt Steckel. Für Barriquefässer muss sie einen Durchmesser von mindestens 35 Millimetern haben.
Der Stamm soll gerade gewachsen sein und im unteren Teil keine Wasserreiser haben. Das sind Äste in dem Abschnitt, der eigentlich schon astfrei ist. Sie bilden sich bei Lichteinfall und entwerten das Holz, weil sich dessen Struktur ändert und die Holzfasern nicht einheitlich verlaufen. Daher achten die Förster darauf, dass ältere Eichen immer von Buchen «als dienende Baumart» umringt sind, um deren Stamm den nötigen Schatten zu spenden, wie Steckel erläutert.
Astfreie Baumstämme im Wert von 300 000 Euro auf dem nahegelegenen Holzlagerplatz Albrechtshain sind der ganze Stolz von Steckel und seinem Kollegen Stefan Seegmüller. «Wenn man als Förster hierherkommt, geht einem schon das Herz auf», sagt Seegmüller. Er befasst sich wissenschaftlich mit der Frage, wie sich verschiedene Herkünfte von Fasshölzern auf Wein auswirken.
In der Luft liegt der Duft von frischem Holz - und von etwas, das ein Laie nur erahnt. «Eichenholz hat viele Gerb- und Aromastoffe, sogenannte Whiskylaktone», erklärt Seegmüller. Sie zeichnen sich typischerweise durch Kokos- und Vanillenoten aus. «Dieser Duft nach frischem Eichenholz findet sich später im Wein wieder.»
Auf dem Holzlagerplatz sucht sich dann der Daubenhauer das richtige Material für den nächsten Arbeitsschritt zum Fass aus. «Ich sehe dem Stamm an, wofür er sich eignet», sagt Christian Müller-Schick aus Kaiserslautern-Mölschbach. «Ein gerader Faserverlauf ist wichtig, weil der Alkohol im Wein dünner ist als Wasser und bei schrägem Verlauf hinauslaufen würde.» Der 37-Jährige ist in dritter Generation tätig, als einziger reiner Daubenhauer in Deutschland.
In seinem Betrieb werden etwa 1,50 Meter lange Stammstücke von Hand mit einem großen axtförmigen Spalter vorsichtig entlang des natürlichen Faserverlaufs zerteilt und anschließend entsprechend zersägt. Bis zu drei Jahre lagert das geschnittene Fassholz im Freien, damit Wind und Wetter bittere Gerbstoffe auswaschen. In dieser Zeit «vergraut» das Holz, laut Müller-Schick ein Zeichen für Qualität. Chemische Behandlungen sind tabu, schließlich soll später ein Lebensmittel mit dem Holz in Berührung kommen.
Ist das Holz soweit vorbereitet, nimmt es der Küfer Michael Gies aus Bad Dürkheim zur Hand. Er achtet auf kleine Porenweite und darauf, dass die Jahresringe eng beieinander liegen. Denn sie bedeuten mildes Holz, wie Förster Seegmüller erklärt. «Mildes Holz ist arm an Gerbstoffen und damit gut für den Wein.» Über Feuer bringen die Mitarbeiter von Gies die mit Wasser befeuchteten Dauben, also die zurechtgesägten Einzelteile des späteren Fasses, in Form. Stahlringe halten die Dauben in Position, die Tonnenform ist schon gut zu erkennen.
Danach kommt der wohl wichtigste Schritt: das Toasting, das in erster Linie für die Aromen im Wein verantwortlich ist. Es bedeutet, dass das fast fertige, aber oben und unten noch offene Fass über einem Eichenholzfeuer innen geröstet wird. «Das Toasting ist der größere Faktor als das Holz», stellt Klaus Briegel, Vorsitzender des Barrique Forums Pfalz, fest.
Geschmacksneutrale Fässer, die vorher gut durch Wasser ausgelaugt worden sind, werden als «weingrün» bezeichnet. «Ein ungetoastetes Fass würde furchtbar schmecken», erklärt Seegmüller. Stephan Attmann vom Weingut von Winningen findet «ein bisschen was Grünes» im Wein aber gut und setzt daher auf ungetoastete Deckel. Küfer Gies dagegen toastet auch die Deckel.
«Der, der toastet, muss das können», sagt der Fassbauer. «Wir brauchen im Prinzip kein Thermometer mehr.» Je nach Temperatur unterscheidet der Fachmann verschiedene Toaststufen, die unterschiedliche Geschmacksnuancen ergeben: Um 160 Grad ist die Rede von Medium Minus, bei 180 bis 200 Grad von Medium, bei 190 Grad von Medium Plus und bei 200 bis 230 Grad von Heavy Toast. Whiskyhersteller lassen Gies zufolge das Fass innen noch eine bis eineinhalb Minuten brennen. Das gibt dann noch mehr Röstaromen.
«Das mengenmäßig wichtigste Aroma ist das Whiskylakton», sagt Seegmüller. Es ist schon im Holz vorhanden und entsteht zusätzlich beim Toasten. Außerdem bildet sich beim leichten Verkokeln unter anderem Vanillin - ein Abbauprodukt von Lignin, dem Stoff in Pflanzen, der zum Verholzen führt. Ein rauchiges Aroma gibt Furan, ebenfalls ein Abbauprodukt beim Erhitzen. Die noch im Holz verbliebenen Gerbstoffe vertiefen später Farbe und Geschmacksstoffe des Weins und wirken konservierend. Je öfter ein Fass mit Wein belegt wird, desto weniger Aromen kann es abgeben. Barriquefässer kommen daher in der Regel nur zweimal zum Einsatz, danach werden sie als Whiskyfässer weiter verwendet.
Seit vor etwa zehn Jahren französische Eichen knapp geworden sind, steigt die Beliebtheit von Eichen aus dem Pfälzer Wald für Fassholz. Den Förstern von Johanniskreuz zufolge kaufen französische Hersteller mittlerweile in großen Mengen dort ein. «Wir haben hier noch einen sehr großen Vorrat an sehr alten Eichen», sagt Steckel. So steht edlen Barriqueweinen auch auf lange Sicht nichts im Weg, weder in Deutschland noch in Frankreich - genug Holz ist jedenfalls da. dpa